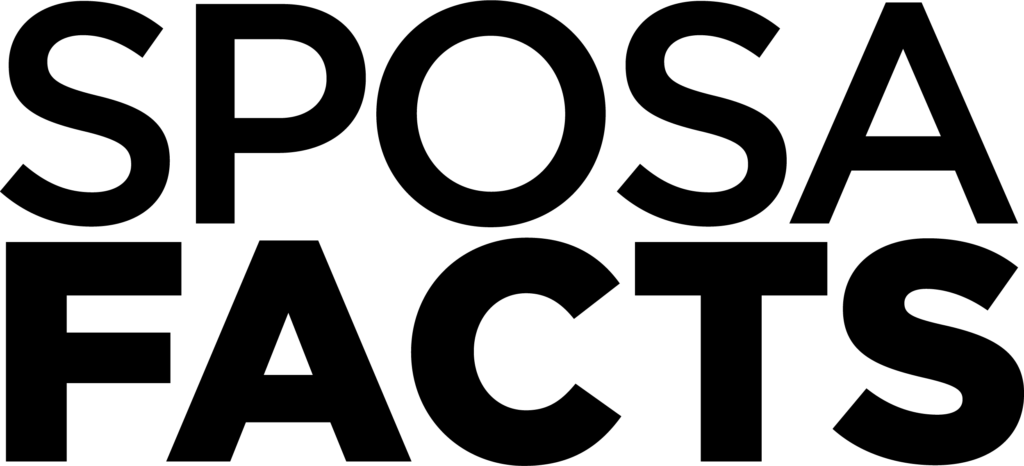Das sind die Empfehlungen der Pricing-Experten
Preise müssen einige Anforderungen erfüllen: Sie sollten alle Kosten decken, konkurrenzfähig sein, zum Kauf animieren und eine angemessene Gewinnspanne eröffnen. „Der Preis beeinflusst das Einkaufsverhalten im Bekleidungsbereich stark. Im Rahmen einer Umfrage des EHI Retail Institutes im Frühjahr 2024 nannten über 50 Prozent der Deutschen den Preis als wichtigsten Faktor für ein gutes Einkaufserlebnis. Auch im Hochzeitssegment ist der Preis relevant, obwohl die Preiselastizität angesichts des emotionalen, einmaligen Kaufs hier höher ist“, sagt Ole Schartl und fügt hinzu: „Jeder Händler braucht je nach Standort, Positionierung und Bestandssituation eine individuelle Pricing-Strategie.“
Häufige Fehler
Steigen wir damit ein, was man nicht tun sollte. Markus Goller zählt auf: „Erstes No-Go ist, dieselbe Marge auf das gesamte Sortiment aufzuschlagen. Differenzierung ist wichtig. Zweitens sollten Preise nicht einfach beim (vermeintlichen) Wettbewerb kopiert werden. Eine ganzheitliche Vorgehensweise ist entscheidend. Drittens sollte das Pricing nicht auf Bauchgefühl beruhen. Es gibt einen Schatz an (Kunden-)Daten, den man nutzen sollte.“
Kunden kennen
„Man muss ein gutes Verständnis der Zahlungsbereitschaft der eigenen Kunden haben und wissen, wo relevante Budgetgrenzen liegen. Darauf sind Angebot und Preise mit entsprechenden Anteilen im Preisaufbau auszurichten und später auch das Beratungsgespräch abzustimmen“, unterstreicht Markus Goller und fügt hinzu: „Allein die Frage nach der Hochzeitslocation kann schon viel über die Zahlungsbereitschaft aussagen.“
Benchmarking betreiben
Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich von Produkten, Dienstleistungen, Prozessen und Leistungskennziffern mit anderen Unternehmen mit dem Ziel, sich erfolgreich mit den Besten zu messen und Optimierungspotenziale aufzudecken. Benchmarking sollte auch im Bereich Pricing stattfinden. Es umfasst laut Ole Schartl folgende Schritte: „Erstens die Wettbewerbsdefinition, das heißt die Identifikation direkter Mitbewerber lokal, national und online. Zweitens die Datenerhebung, konkret die Erfassung von Preisinformationen inklusive des Abschriftenverhaltens im Zeitverlauf. Quellen sind Webseiten, Social Media, Newsletter, Schaufenster, Mystery Shopping oder das Benchmarking-Panel, das h+p bietet. Drittens die Analyse der erhobenen Daten im Detail inklusive Vergleichen der Preisniveaus. Und viertens die Ableitung abgestimmter Maßnahmen zur Justierung der eigenen Preise, zur Einführung oder Anpassung von Rabatten und der Definition von Zusatzleistungen beziehungsweise Services.“
Preise differenzieren
Aus Sicht von Markus Goller ist Differenzierung die „Königsklasse des Pricing“. Heutige Kunden vergleichen Preise sowohl online als auch stationär. Händler sollten wissen, auf welche Artikel die Kunden preislich besonders achten. „Wenn der Preis von Smoking XY beispielsweise weit bekannt ist, sollten Händler hier preislich eher etwas aggressiver vorgehen. Denn bei diesen Produkten bildet sich das Preisimage, man kann sonst schnell als teuer wahrgenommen werden. Bei Artikeln, die weniger im Fokus stehen, kann indes mehr verlangt werden. Hier liegt der Gewinn.“
Preisschwellen beachten
Die Auswertungen sowohl von Simon-Kucher als auch h+p belegen immer wieder: Es gibt psychologische Preisschwellen. „An gewissen Schwellen verringert sich der Anteil der Kunden, die zu diesem Preis kaufen würden, markant“, bemerkt Markus Goller und nennt als Beispiel: „999 oder 1.000 Euro machen einen großen Unterschied. Denn wir sind als Kunden nicht rational. Händler sollten die Preisschwellen kennen und ihre Preise möglichst nah darunter positionieren.“
UVP beim Wort nehmen
Die UVP sollte wörtlich genommen werden. Es ist eine unverbindliche Preisempfehlung. „Händler sollten sie als Ausgangsbasis betrachten und ihre Qualität prüfen“, empfiehlt Markus Goller als ersten Schritt. „Insbesondere, wenn Wettbewerber am Standort oder der Hersteller diesen Preis im eigenen Online-Shop nutzt, kann eine Orientierung an der UVP sinnvoll sein“, so Ole Schartl.
Marken und Kalkulationsware mischen
„Bekannte Marken fördern nachweislich das Kaufverhalten“, unterstreicht Ole Schartl und fährt fort: „Es ist individuell abzuwägen, wie wichtig die Markenstrahlkraft im jeweiligen Sortiment und je nach Positionierung ist. Im Regelfall ist eine ausgewogene Mischung aus Marken- und Kalkulationsware für den wirtschaftlichen Erfolg entscheidend, wobei erfahrungsgemäß ein Anteil von etwa 15 bis 25 Prozent Kalkulationsware als durchsetzbar gilt.“
Markus Goller erklärt: „Letztlich lautet die für die Preissetzung zentrale Frage: „Wie einzigartig ist ein Artikel für meinen Store? Weitgehende Exklusivität erhöht den Spielraum der Gestaltung.“ Ole Schartl bestätigt: „Wenn am Standort kein direkter Wettbewerb besteht, beziehungsweise Eigenmarken oder White Labels auch online kaum vertreten sind, ist eine höhere Preissetzung möglich.“ Markus Goller ergänzt: „Bei Eigenmarken ist die Wertkommunikation wichtig.“
Value for money bieten
Ole Schartl empfiehlt: „Höhere Preise lassen sich beispielsweise auch durch ein starkes Serviceangebot rechtfertigen.“ Oder wie es Markus Goller ausdrückt: „Einen guten Händler charakterisiert, dass sich nicht alles nur um den Preis dreht. Das Gesamtbild ‚value for money‘ muss stimmen und das kann am Ende auch erfolgreich in der Aussage münden: ‚Der Einkauf war zwar jetzt nicht günstig, aber toll‘.“
Preisanker setzen
„Man sollte die Funktion der Produkte im Blick haben“, rät Markus Goller und macht dies an einem Beispiel deutlich: „Im Schaufenster hängt ein vergleichsweise teures Kleid, das sich nur selten verkauft. Der Händler kann folgende Schlüsse ziehen: ‚Das muss ich rabattieren.‘ oder ‚Ich nehme es aus dem Fenster/Sortiment‘ oder: ‚Das Kleid hat optisch Anziehungskraft und ist ein kluger Preisanker.‘ Denn: Es strahlt auf andere Produkte ab. Kunden, die den Store betreten, freuen sich umso mehr, wenn sie feststellen: Es gibt auch deutlich günstigere Produkte.“
Automatisieren
Mancher Hochzeitsmodehändler hat eine drei- bis vierstellige Anzahl an Artikeln. „Automatisierung ist an dieser Stelle mit Blick auf Effizienz und Fehlervermeidung ratsam“, empfiehlt Markus Goller. Simon-Kucher bietet mit „Dynamica Retail“ eine Software-Lösung zur dynamischen Preissetzung an. Auch h+p hat ein Tool auf Basis Künstlicher Intelligenz entwickelt, mit dem Preise dynamisch nach aktuellen Marktverhältnissen und anderen Einflussfaktoren vorgeschlagen werden. Für die praktische Umsetzung wird ein digitales Preisetikett am Artikel benötigt. „Diese Etiketten sind längst eine Überlegung wert“, findet auch Markus Goller und verweist auf die Möglichkeiten, die sich ergänzend eröffnen, von Inszenierung und Storytelling bis hin zur Nutzung als Crossselling-Tool.
Richtig rabattieren
„Preisreduzierungen sind wahrscheinlich der größte Ertragskiller im Handel und in der Branche unterschätzt“, mahnt Ole Schartl. In den Auswertungen von h+p werden die Preisabschriften daher in Prozent vom Umsatz dargestellt, so wie es häufig auch bei anderen Kosten, zum Beispiel Personal- oder Werbekosten, üblich ist. „Das hilft, die Ertragswirksamkeit besser einzuordnen.“
Ole Schartl betont gleichzeitig: „Preisreduzierungen sind natürlich ein benötigtes Instrument, insbesondere, wenn man sich von ‚toter‘ Ware trennen will.“ Sobald eine UVP nach unten verlassen werden soll, ist vorab stets die Frage zu stellen: „Kann ich in dem Ausmaß mehr Volumen generieren?“, macht Markus Goller aufmerksam und geht auf verschiedene Rabattierungsarten ein: „Das Gießkannenprinzip, beispielsweise 20 Prozent auf alles, sehe ich in der Hochzeitsmodenbranche skeptisch. Es sollte, um im Bild zu bleiben, lieber gezielt die Wasserpistole je nach Artikel zum Einsatz kommen. Darüber hinaus sind sogenannte Bündelrabatte – zum Beispiel Rabatte auf den Komplettoutfit-Kauf – eine Form, die auch öffentlich sichtbar gemacht werden kann. Kundenindividuelle Rabatte kommen in Frage, wenn man sonst Gefahr läuft, zu keinem Verkaufsabschluss zu kommen. Aber dafür braucht es klare Regeln für das Verkaufspersonal und das Gespür: Welchen Typ Kunden habe ich vor mir?“
Das kosten Rabatte
Ole Schartl: „Eine Preisreduzierung von zehn Prozent auf den UVP macht bei einer gängigen Wareneingangskalkulation von 150 Prozent (Aufschlag) bereits 4,4 Prozentpunkte weniger Brutto-Ertrag aus (gemessen an der erzielten Bruttokalkulation). Ein anderes plakatives Beispiel bei gleicher Wareneingangskalkulation: Bei einer Preisreduzierung von 30 Prozent auf den UVP muss der Handel die doppelte Stückzahl für denselben Ertrag verkaufen!“
Markus Goller erklärt es so: „Der Einkaufspreis ist ins Verhältnis zum Nettoverkaufspreis zu setzen und auf allen Rabattstufen zu vergleichen. Das ist ein einfacher Dreisatz, den sich die Händler tabellarisch darstellen können, immer verbunden mit der Frage: „Welches Plus an Volumen muss bei welcher Rabattierung erzielt werden?“ Meist wird sichtbar: Schon kleine Rabatte können schmerzhaft sein.
TEXT: Stefanie Hütz